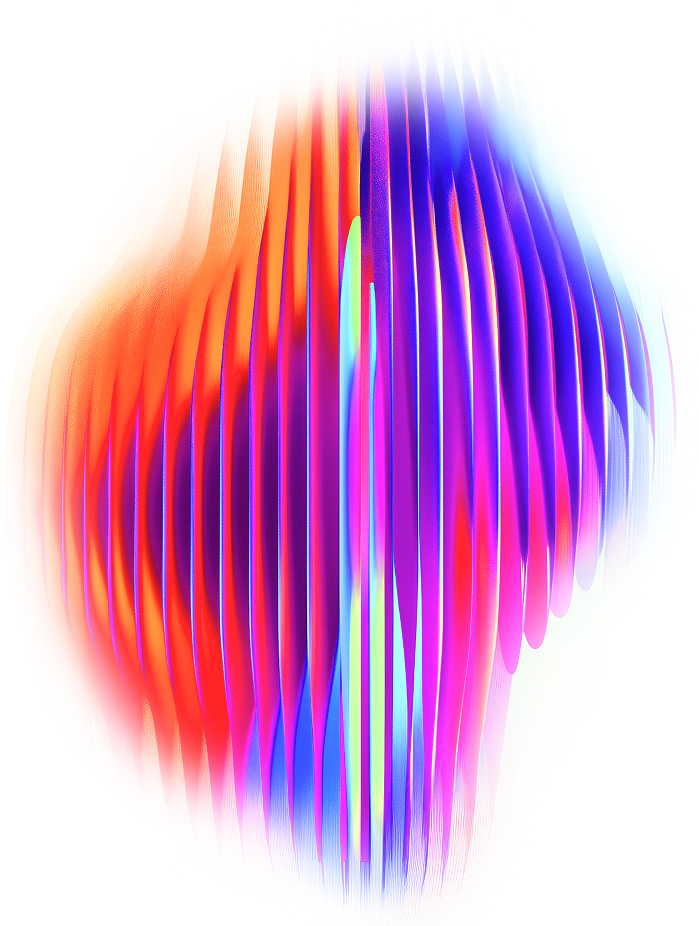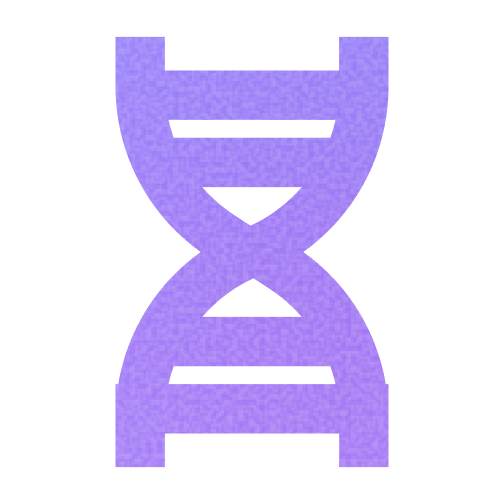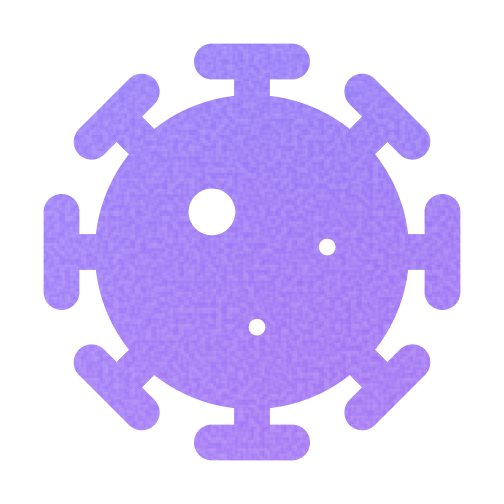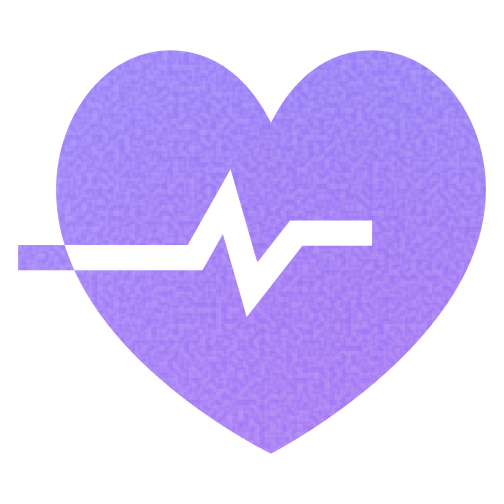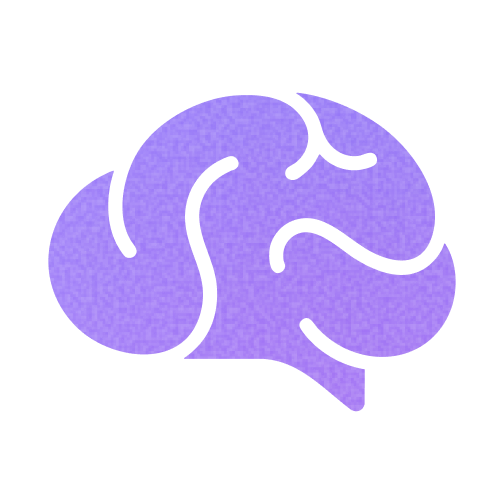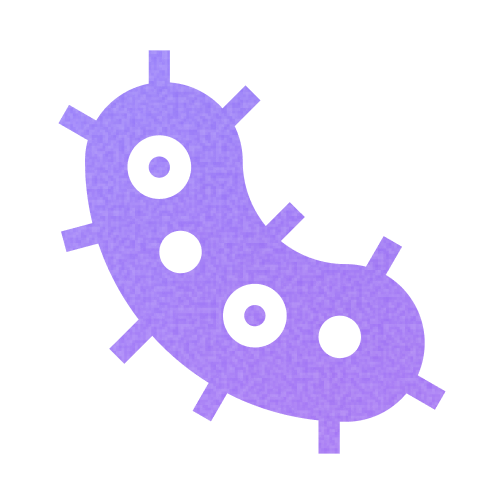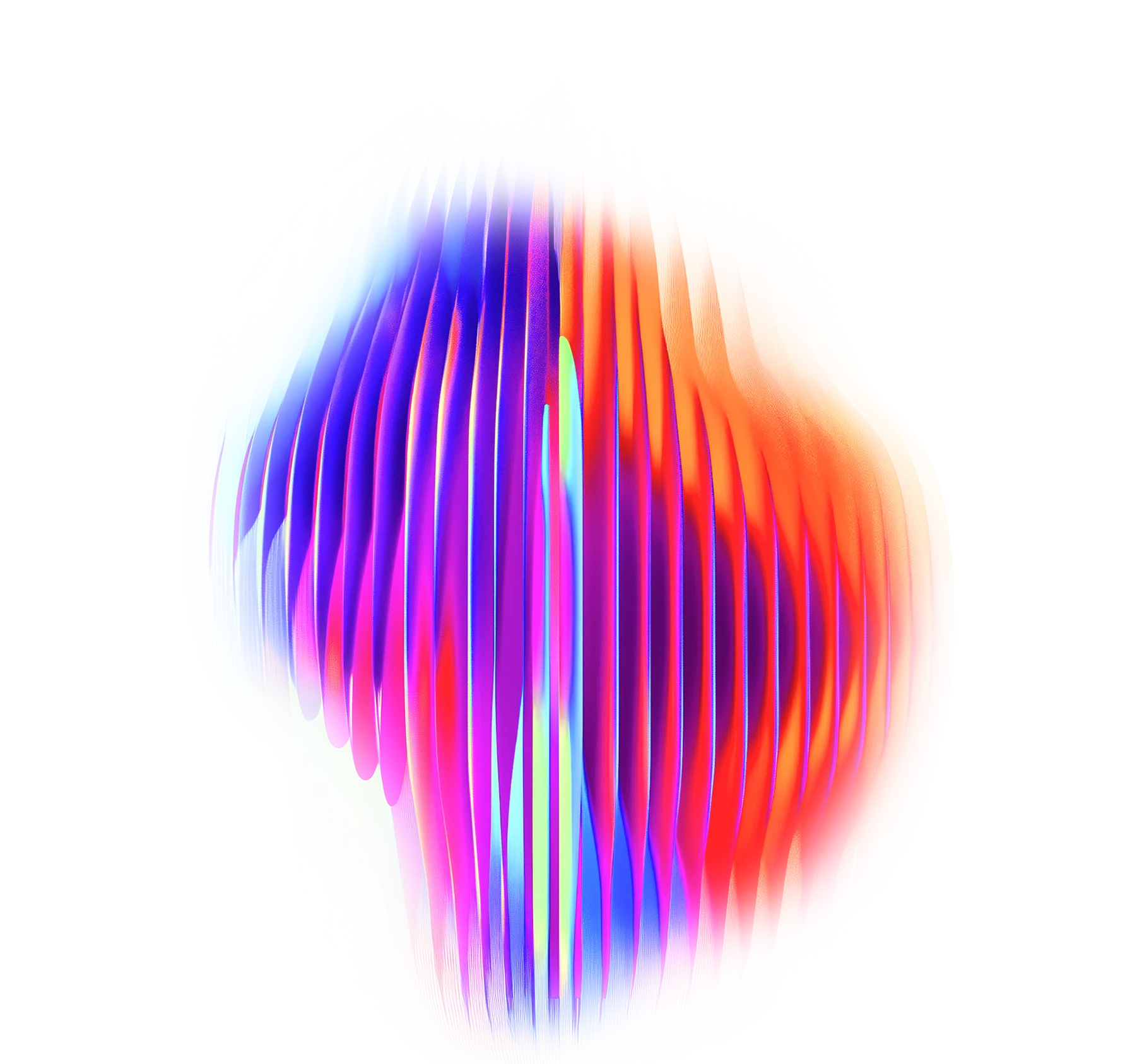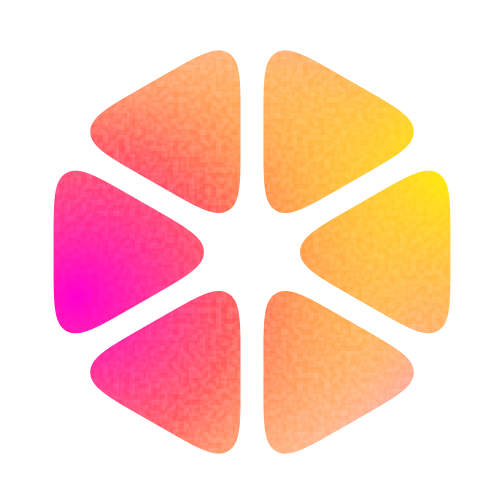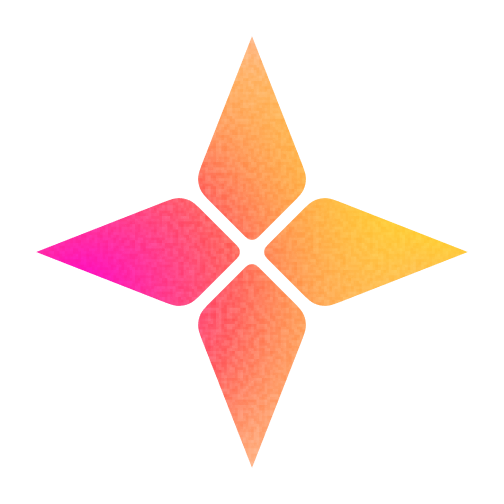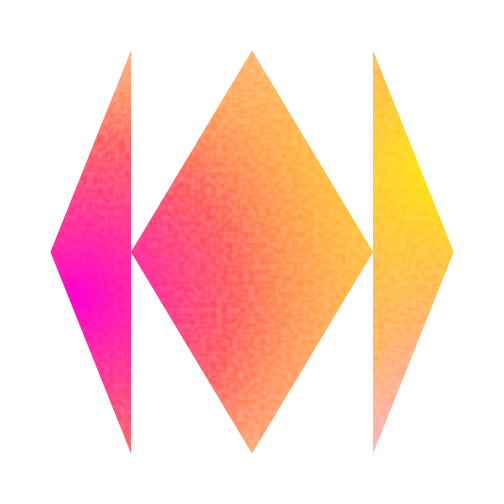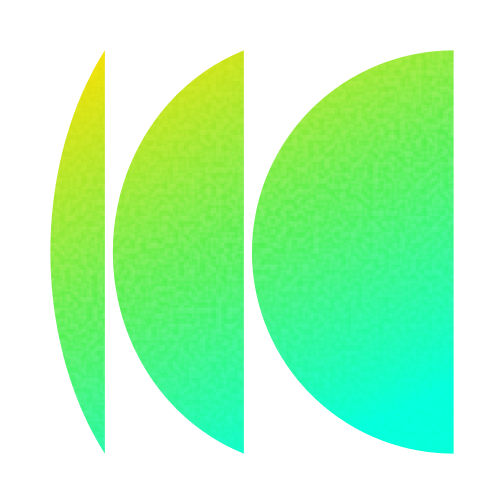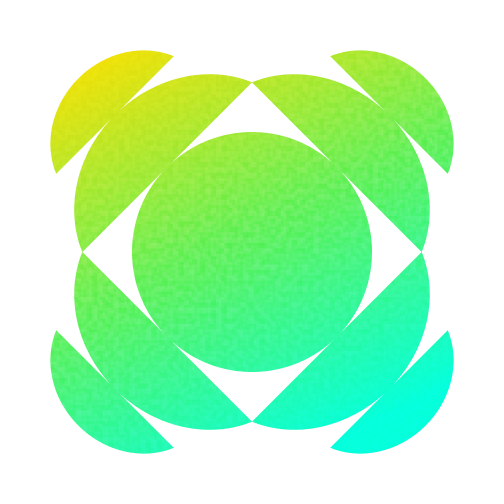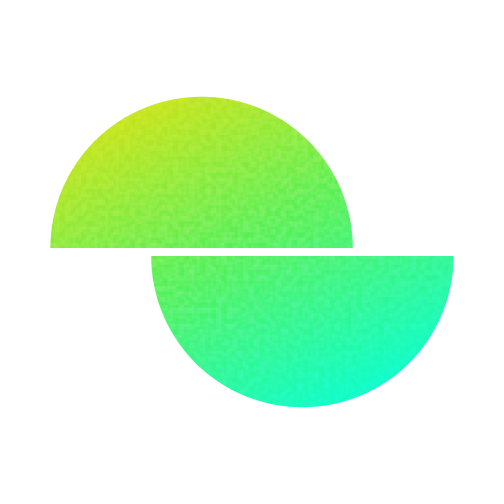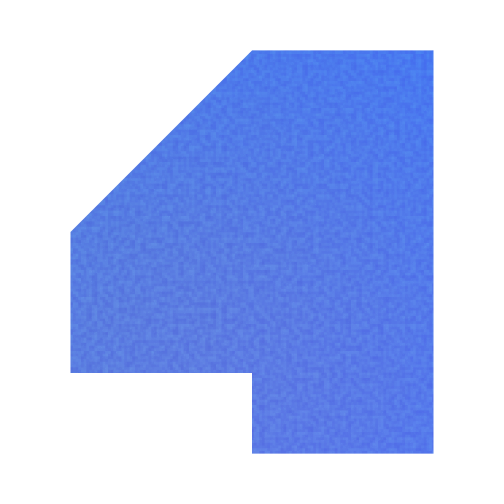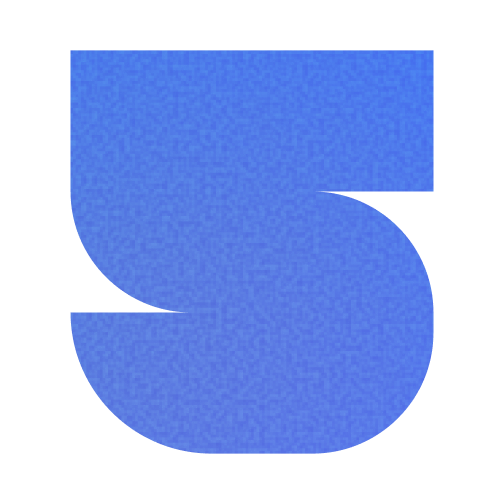Studien einfach erklärt
Klinische Studien sind essenziell für die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden. Oft wirken sie komplex und unverständlich – insbesondere für fachfremde Personen. Doch das Verständnis klinischer Studien kann die Grundlage fundierter Entscheidungen für die eigene Gesundheit sein. Was genau ist eine klinische Studie? Welche Arten gibt es und wie läuft eine Studie ab? Hier erfahren Sie, was das bedeutet – damit Wissenschaft kein Fachjargon bleibt.
Was ist eine klinische Studie?
Klinische Studien sind wissenschaftliche Untersuchungen, mithilfe derer die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit neuer Behandlungsmethoden und Medikamente geprüft werden. Sie sind ein wesentlicher Schritt im Entwicklungsprozess und Voraussetzung für die Zulassung neuer Medikamente. Klinische Studien sind die Grundlage für neue Diagnose-, Therapie- und Präventionsmethoden, um langfristig die medizinische Versorgung zu verbessern.
Klinische Studien haben unter anderem folgende Ziele:
Typische Einsatzgebiete von klinischen Studien
Klinische Studien finden besonders häufig in folgenden Bereichen statt:
Krebsmedizin (Onkologie)
– etwa um neue Wirkstoffe, Immuntherapien oder kombinierte Behandlungen zu testen
Infektionskrankheiten
– z. B. Impfstoffstudien wie bei COVID-19 oder HIV-Behandlungen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Kardiologie)
– wie zur Entwicklung von Medikamenten gegen Bluthochdruck
Neurologische und psychische Erkrankungen
– zur Forschung und Therapie bei Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Depression
Seltene Erkrankungen
– zur Forschung bei sogenannten Orphan Diseases, wie seltenen Krebs- und Autoimmunerkrankungen
Klinische Studien: Ablauf und Phasen
Vor allem bei der Entwicklung von neuen Therapien und Medikamenten gibt es klare Phasen, die jede Studie durchlaufen muss.
Von der Forschung bis zur Zulassung
-
Zellkultur und Tierversuch

Sind schwere Schäden wie Krebs oder Erbgutschäden hinreichend unwahrscheinlich?
Nur dann folgen klinische Studien.
-
Phasen
Klinische Studien gliedern sich vor der offiziellen Zulassung in drei Phasen. Alle Details zum Ablauf finden Sie unter: So laufen klinische Studien Schritt für Schritt ab -
Phase 4
Nach der Zulassung kann man weitere Daten erheben, um Wissenslücken zu schließen und die Patientensicherheit zu gewährleisten.
So laufen klinische Studien Schritt für Schritt ab
-
Phase-1-Studie
- Ziel: Finden der optimalen Dosierung und Untersuchung der Sicherheit
- Teilnahme: Patient:innen mit weit fortgeschrittener Erkrankung oder Gesunde
- Größe: ca. 20-80 Teilnehmende
- Dauer: Wochen bis Monate
-
Phase-2-Studie
- Ziel: Feststellung der Effektivität und Untersuchung der Sicherheit
- Teilnehmende: Patient:innen mit der entsprechenden Erkrankung
- Größe: ca. 100-800 Teilnehmende
- Dauer: Wochen bis Monate
-
Phase-3-Studie
- Ziel: Vergleich von Wirksamkeit und Sicherheit mit der bisherigen Standardtherapie
- Teilnehmende: Patient:innen mit der entsprechenden Erkrankung
- Größe: ca. 100-3.000 Teilnehmende
- Dauer: Monate bis Jahre
-
Phase-4-Studie
- Ziel: Anwendung unter alltäglichen Bedingungen
- Teilnehmende: Patient:innen mit der entsprechenden Erkrankung
- Größe: ca. 500-15.000 Teilnehmende
- Dauer: Monate bis Jahre
Sicherheit und Ethik: Wesentlich bei klinischen Studien
Klinische Studien unterliegen strengen gesetzlich vorgeschriebenen Standards zur Sicherheit und Ethik. Diese Regeln müssen in jeder Phase der Studie eingehalten werden. Auch bevor eine Person teilnimmt, sind strenge Abläufe und Regeln zu berücksichtigen. Denn oberste Priorität haben die Rechte und das Wohl der Teilnehmenden.
Folgende zentrale, nationale und internationale Maßnahmen gibt es:
Prüfplan
Jede klinische Studie basiert auf einem Prüfplan. In diesem zentralen Dokument werden unter anderem Ablauf, Methodik, Kriterien für Teilnehmende, Therapie, Dauer und sämtliche Maßnahmen zur Finanzierung, Datenerfassung und Risikominimierung für teilnehmende Personen festgehalten. Durch den Prüfplan sollen klinische Studien sicher, wissenschaftlich korrekt und einheitlich umgesetzt werden.
Ethikkommission
Vor dem Start wird jede klinische Studie von einer unabhängigen Ethikkommission geprüft. Diese untersucht, ob die Studie für Teilnehmende ethisch vertretbar sowie sicher ist und wissenschaftlich sinnvoll. Nur mit der Genehmigung der Ethikkommission kann eine Studie durchgeführt werden.
Zulassungsbehörde
Neben der Überprüfung durch die Ethikkommission müssen klinische Studien auch von nationalen Zulassungsbehörden genehmigt werden. In Deutschland sind beispielsweise das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) oder das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zuständig. Jede Studie, die in der EU durchgeführt wird, muss zudem eine Genehmigung gemäß der EU Clinical Trials Regulation (EU-CTR) einholen.
Aufklärung
Nach der Genehmigung der entsprechenden Instanzen werden teilnehmende Personen gesucht und umfangreich über die Studie aufgeklärt. Hierbei ist eine vollständige Transparenz über den Ablauf, Nutzen und mögliche Risiken vorgesehen.
Einwilligung
Teilnehmende Personen müssen freiwillig und schriftlich der klinischen Studie zustimmen. Ohne die schriftliche Zustimmung ist die Teilnahme nicht möglich. Die Einwilligung kann erst nach der umfangreichen Aufklärung eingeholt werden.