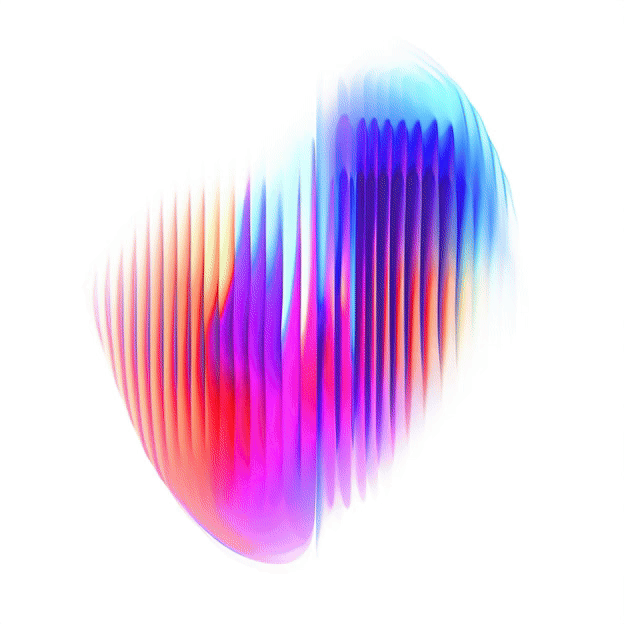"Ohne Forschung wäre ich nicht hier"
Ein Erfahrungsbericht von Babett Baraniec.
Welche Bedeutung haben Studien für Ihren Krankheitsverlauf?
Eine große. Ich werde seit vielen Jahren in zertifizierten Tumorzentren behandelt, wo der Zugang zu Studien leichter ist. Meine einzige Medikamentenstudie war vor etwa sieben Jahren – mit einem Tyrosinkinasehemmer, um das Rezidivrisiko bei Leberkrebs zu senken.
Ich wurde von meinem Arzt direkt angesprochen, die Studie lief in meiner vertrauten Umgebung, ich musste nirgendwo hinfahren. Das war organisatorisch einfach. Leider musste ich nach drei Monaten wegen starker Nebenwirkungen aussteigen. Trotzdem folgte danach meine längste rezidivfreie Zeit – über zwei Jahre. Ob das am Medikament lag, kann man nicht sicher sagen.
Aber klar ist: Auch negative Studienergebnisse bringen uns weiter. Forschung bedeutet immer Lernen – selbst dann, wenn etwas nicht funktioniert.
Sie spenden regelmäßig Körpermaterial. Warum ist das wichtig?
Vor jeder Operation werde ich gefragt, ob ich übrig gebliebenes Material aus der Leber zur Verfügung stelle – und ich sage immer Ja. Das ist wirklich wichtig, weil Forschende auf solche Proben angewiesen sind. Ohne unser Material könnten viele Analysen gar nicht stattfinden. Es wäre schade, das einfach wegzuwerfen.
Auch wenn mal ein, zwei Röhrchen Blut mehr abgenommen werden – das bildet sich wieder. Seit zwölf Jahren stelle ich regelmäßig Proben zur Verfügung: Blut, Gewebe, manchmal auch Restmaterial. Damit können zirkulierende Tumorzellen oder Biomarker untersucht werden, die zeigen, ob eine Therapie anspricht. Für mich ist das selbstverständlich – ein kleiner Beitrag mit großer Wirkung.
„Für mich persönlich ist Forschung lebenswichtig“
Wie begegnen Sie Ängsten oder Vorurteilen gegenüber Studien?
Ich verstehe diese Sorgen. Aber für mich persönlich ist Forschung lebenswichtig. Ohne sie wäre ich nicht mehr hier – seit 11 Jahren bin ich metastasiert und hätte sonst keine Chance gehabt, meine Tochter aufwachsen zu sehen. Nur durch Forschung entwickeln sich Therapien weiter.
Viele Menschen außerhalb dieses Settings spüren diesen Nutzen nicht so direkt. Sie lesen viel im Internet – über Pharmainteressen, über angebliche Risiken – und verlieren Vertrauen. Ich glaube, da braucht es mehr Aufklärung. Wir sollten lernen, Forschung als etwas Gesellschaftliches zu begreifen. Was heute erforscht wird, kann morgen unser Leben retten. Wir alle werden älter – und was wir heute unterstützen, kann uns eines Tages selbst helfen.
Was war an Studien für Sie besonders fordernd?
Manchmal sind Studien einfach anstrengend. Zum Beispiel, wenn ich über Monate regelmäßig Fragebögen ausfüllen und zurückschicken sollte. Dann kam das Leben dazwischen – ich bin Mutter, chronisch krank, habe Arzttermine, manchmal auch einen Progress. Da bleibt so ein Fragebogen liegen, weil ich schlicht keine Energie mehr habe.
Ich glaube, vielen geht es so. Wir wollen mitmachen, aber die Hürden sind hoch: Postwege, Papierkram, lange Fahrten zu den wenigen Studienzentren. Da würde es wirklich helfen, wenn vieles digitaler und einfacher wäre.
Wie ermutigen Sie Unentschlossene?
Man sollte Nutzen, Risiko und Aufwand abwägen – und sich ruhig Unterstützung holen. Wichtig ist, sich vorher klarzumachen: Warum will ich teilnehmen? Geht es um Hoffnung, um Lebensqualität, um den Beitrag zur Gemeinschaft? Nicht jede Studie bringt individuellen Nutzen, aber jede gute Studie kann die Versorgung verbessern.
Und ganz wichtig: Ich darf auch aussteigen, wenn ich merke, dass ich es gerade nicht schaffe. Das ist kein Versagen. Denn gerade die Studienteilnahme für Krebspatient:innen kann ein großer Aufwand sein – körperlich, emotional, organisatorisch. Niemand sollte sich unter Druck gesetzt fühlen, etwas durchzuhalten, das gerade zu viel ist.